Das Tourleben ist Sehnsuchtsort und Paralleluniversum gleichzeitig – ein fahrender Rock’n’Roll-Zirkus, von dem viele Musiker*innen träumen. Einer, der davon nicht mehr träumen muss, weil er seit Mitte der 60er fast nichts anderes tut, als auf Tour zu gehen, ist Alice Cooper. Und weil der inzwischen 75-jährige Meister des Schockrock es immer noch liebt, durch die Lande zu reisen und mit seiner grandiosen Liveband für seine Fans zu spielen, hat er sein neues Album ROAD um eben jenen Kosmos herum konzipiert. Es geht um schmerzliche Abschiede, flüchtige Liaisons, nicht enden wollende Highways, Groupies, Exzesse, die Roadcrew und den Adrenalinrausch bei Konzerten. Beim Songwriting hat er dabei konsequenterweise seine Liveband – bestehend aus Tommy Henriksen, Ryan Roxie und Nita Strauss (Gitarren), Chuck Garric (Bass) und Glen Sobel (Drums) – ins Boot geholt. Außerdem sind die Gastmusiker Kane Roberts, Tom Morello (Rage Against The Machine), Keith Nelson (Buckcherry) und Wayne Kramer (MC5) auf ROAD zu hören. Die genauen Hintergrundinformationen zur Genese der wirklich gelungenen Platte und das Geheimnis, wie man das Tourleben körperlich und psychisch unversehrt übersteht, verriet uns Mr. Cooper im Telefoninterview:
Ist ROAD die logische Konsequenz daraus, dass Alice Cooper nach der Pandemie wieder touren darf?
Oh ja! Und außerdem kommt es nicht allzu oft vor, dass du eine Tourband hast, die so gut ist, dass du unbedingt mit ihr angeben willst. (lacht) Ich wollte meine Band in den Albumprozess integrieren. Eigentlich schreiben Bob Ezrin [Coopers langjähriger Produzent und Arbeitspartner. Anm. d. Red.] und ich die Songs, diesmal wollte ich jedoch, dass die Band das tut. Anschließend dokterten Ezrin und ich an ihren Ideen herum, um sie zu unseren Liedern zu machen. Darüber hinaus wollte ich, dass sie all diese Tracks live im Studio einspielten – es gibt nur wenige Overdubs. Und da ich diese Menschen eigentlich nur sehe, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, haben wir diese Platte logischerweise über das Leben auf Tour geschrieben. Über die Busfahrer, die Hotelzimmer, darüber, deine Frau zuhause zurückzulassen – mit meinen Texten habe ich diese Tracks zu ROAD-Songs werden lassen.

Hast du deiner Band irgendwelche Vorgaben gemacht?
Nicht wirklich, die wissen ja, wie Alice Cooper klingen muss. Nita beispielsweise ist jünger als alle anderen, sie ist viel stärker von Bands wie Rage Against The Machine beeinflusst – also sagte ich: kein Problem, dann arbeite an Nummern, die in diese Richtung gehen. Der einzige Unterschied zwischen Metal und Hard Rock ist am Ende eh nur die Haltung dahinter, aber es ist schon klar, dass wir nicht in die heavy, heavy Metal-Ecke abdriften bei Alice Cooper.
ROAD kommt ja nur zwei Jahre nach DETROIT STORIES heraus – ein solider Workflow für einen beschäftigten Mann wie dich. Wann habt ihr mit den Arbeiten an ROAD begonnen?
Wir denken immer weit im voraus. Ezrin und ich haben ja nicht nur ROAD fertig gestellt, sondern gerade auch schon 75% einer weiteren Platte abgehakt. Alice Cooper hat eine lange Historie und viele Menschen lieben besonders die alten Alben. Das verstehe ich, lebe jedoch überhaupt nicht in der Vergangenheit. Fast täglich erzählt mir irgendwer: ‚Hey, heute ist der Jahrestag von PRETTIES FOR YOU‘ oder so etwas und ich habe keinen blassen Schimmer, weil mich das nicht wirklich interessiert. (lacht) Ich denke lieber an das nächste und übernächste Album nach. Und dann steht ja mit den Hollywood Vampires auch noch irgendwann ein Album an.
Wieder mal hast du herrlich spitzzüngige Texte auf ROAD versammelt. Wie viele der Textideen hast du aus deinem persönlichen Erfahrungsfundus geschöpft?
Ich denke, ich suche in jeder Situation nach dem gewissen Quäntchen Humor. Zum Beispiel diese Geschichte über ein paar Typen, die an der Raststätte halten, um etwas zu essen. Die Kellnerin kommt, einer der Typen schaut auf ihre Schuhe und sagt: „She’s got big boots“ [„Sie hat große Stiefel.“ Anm. d. Red.] Jeder denkt, dass er auf ihre „big boobs“ [große Brüste. Anm. d. Red.] anspielt, doch er redet von ihren Schuhen. So etwas finde ich einfach lustig. (lacht) Es gibt natürlich auch Lieder, die nicht sonderlich witzig sind. ›Baby Please Don’t Go‹ beispielsweise erzählt von der Situation, wenn du dein Zuhause für die Tour verlassen musst. Der Typ im Lied steht morgens auf, ist schon fast bei der Tür draußen und seine Frau oder Freundin sagt: „baby, please don’t go!“ Das bricht dir das Herz, weil du ja weißt, dass du losziehen musst. Und sie weiß auch, dass du losziehen musst. Dieser letzte Versuch einer Bitte, das kann echt hart sein. Diesen Herzschmerz wollte ich einfangen. Tracks wie ›White Line Frankenstein‹ hingegen sind wieder sehr ulkig.
Wie bist du mit diesen ›Baby Please Don’t Go‹-Momenten in deiner Karriere umgegangen?
Meine Frau war Teil der Band ab WELCOME TO MY NIGHTMARE, sie war damals 18. Nach vier oder fünf Jahren bekamen wir unser erstes Kind, also musste sie die Tour verlassen, was echt schwer für sie war, weil sie als Primaballerina ja dort aufgewachsen war. Doch es half nichts, sie zog die Kinder groß, ich suchte nach einem Ersatz für sie. Als unsere Kinder schließlich alt genug und aus dem Haus waren, sagte ich sofort zu meiner Frau: „Sheryl, du musst wieder mit auf Tour kommen!“ Seit etwa acht Jahren ist sie also wieder mit dabei. Das ist herrlich, weil ich diese Abschiedsmomente jetzt nicht mehr durchmachen muss. Doch es gab Zeiten, da war es anders und das war schwer. Ich habe ein Foto im Haus davon, wie wir uns am Flughafen in Los Angeles voneinander verabschieden – puh, ganz schön hart! Wahrscheinlich habe ich deshalb diesen Song geschrieben.
Das glaube ich, du hast ja nicht nur deine Frau, sondern auch deine Kinder verabschieden müssen.
Absolut. Und inzwischen sind noch meine fünf Enkelkinder dazugekommen, großartige kleine Menschen, die auch alle einen tollen Sinn für Humor haben. Sie alle kapieren komplett, worum es bei Alice Cooper geht. (lacht)
Apropos: Der Opener ›I’m Alice‹ ist eine kleine Vorstellungsrunde mit einem herrlichen Spoken-Word-Teil, in dem du wortreich erklärst, dass Alice eine Projektionsfläche ist. Wofür eigentlich? Was projizieren die Leute in diese Figur?
Ich glaube, die Menschen haben inzwischen verstanden, dass Alice Cooper ein Charakter ist, den ich spiele. Ansonsten wäre ich schon im Knast oder tot! (lacht) Ryan Roxie brachte diesen Song rein und ich brachte Alice Cooper hinein, diesen arroganten Bösewicht, der dem Publikum erzählt, wie großartig er doch ist. Das bringt mich zum Lachen! (lacht) Er erklärt, wer er ist. Ich wollte das Ganze sehr theatralisch gestalten, ein bisschen, als würde Captain Hook sich selbst vorstellen. Dann gibt es auch noch den Song namens ›Rules Of The Road‹, darin kommt ein Typ vor, der mit jungen Rockmusikern spricht und ihnen nur falsche Ratschläge gibt. (lacht) Nach dem Motto: ‚Wenn ihr all diese Regeln befolgt, verreckt ihr bevor ihr 27 Jahre alt seid‘.
Die Frage, die sich nach Hören dieses Songs aufdrängt: Wie oft hast du im Laufe deiner Karriere dein Geld nach einem Gig nicht bekommen? Das betonst du ja mehrmals.
Shep Gordon ist ja seit Ewigkeiten mein Manager, genauer gesagt seit 55 Jahren. Wir haben nicht mal einen Vertrag oder so etwas, wir arbeiten einfach zusammen. Das ist wahrscheinlich die einzige frühe Künstler-Manager-Geschichte in der Historie der Rockmusik, die gut gegangen ist. (lacht) Er sagt immer zu allen: ‚erste Regel – hol das Geld. Zweite Regel – vergiss nicht, das Geld zu holen. Dritte Regel: Denk immer daran, nicht zu vergessen, das Geld zu holen!‘ (lacht) In den frühen Tagen mussten wir echt öfter Mal um unsere Gage kämpfen, deswegen ist das quasi ein running Gag unter uns. Ich erinnere mich daran, wie wir mal eine Show in Mexico spielten, das war eh schon immer ein wenig riskant. Also wollte Shep das ganze Geld haben, bevor wir einreisten, was echt eine gute Idee war, weil der Promoter der Show einen Tag vor unserem Konzert ausgeraubt wurde – die ganze Kohle wäre also weg gewesen. Das sind so Dinge, die ein guter Manager für dich regelt. (lacht)
Ich finde es spannend, dass dieses Album eine Hommage an das Tourleben ist. Viele deiner Altersgenossen erzählen mir, dass das Touren für sie ziemlich anstrengend geworden ist.
Jeder hat einen anderen Tour-Stil. Erst letztens sprach ich mit Johnny Depp und Joe Perry über dieses Thema. Die beiden bleiben immer in ihren Hotelzimmern. Meine Frau und ich hingegen stehen morgens auf und gehen raus, wir bummeln, essen zu Mittag. Ich könnte das nicht aushalten, nur in meinem Hotel herumzusitzen. Aber für Johnny und Joe ist das der beste Weg. Jeder muss einen Weg finden, um mit der Straße klarzukommen. Ich habe mein halbes Leben auf ihr verbracht, ich habe gelernt, sie zu lieben. Ich mag es immer noch sehr, zu reisen.
Die Tour ist ja wie ein mystisches Paralleluniversum, das viele sehr anzieht. Wie du in einem Song ironisch erzählst, birgt dieses Paralleluniversum durchaus Gefahren, vor allem für junge Musiker*innen. Kann das Leben auf Tour den Charakter verderben?
Ohja, ich denke schon. Alice ist meine Art, damit umzugehen. Ich habe Alice erfunden, um meinen persönlichen Lieblingsrockstar verkörpern zu können. Ich habe mich gefragt, wie ich mir als Zuschauer meinen persönlichen Rockstar vorstellen würde. Ich kann also ehrlich sagen, dass Alice mein liebster Rockstar ist und ich es liebe, ihn zu spielen.
Aber da liegt der Unterschied: du spielst ihn…
Ganz genau! Es gab Zeiten, als ich trank und Drogen nahm, wo ich nicht mehr wusste, wo Alice aufhört und ich anfange. Als ich vor 40 Jahren nüchtern wurde, habe ich gelernt, die beiden zu trennen und seitdem liebe ich es, Alice zu mimen. Ich weiß nicht, ob es anderen Künstlern da draußen ähnlich geht. Bei Mick Jagger ist es bestimmt auch so, der ist auf der Bühne auch anders.
Birgt das Tourleben die Gefahr, dass man schlechtes Verhalten an den Tag legt? Man andere Menschen respektlos behandelt, weil man sich in diesem Paralleluniversum verliert?
Ich denke durchaus, dass das möglich ist. Schon als ich jung und auf Tour war, war ich stets sehr vorsichtig. Meine ganze Band war vorsichtig. Damals war das, als würde man ein Kind in einem Süßigkeitenladen loslassen. Du bekamst alles, was du wolltest. Und trotzdem bzw. gerade deswegen darf man seinen eigenen moralischen Kompass nicht verlieren. Und es gibt Bands, die haben so etwas gar nicht – Moralvorstellungen oder ähnliches. Sie nehmen sich alles, was sie kriegen können. Und eventuell müssen sie irgendwann dafür bezahlen. In den 60ern und 70ern war alles total verrückt und da ich das alles mitbekommen habe, kann ich nur sagen: Ja, wenn man als Band rücksichtslos handelt, ist das durchaus möglich.
Was sind einige ehrliche Tourregeln, wenn man nicht vor dem 27. Geburtstag das Zeitliche segnen will?
Die Show muss der wichtigste Teil des Tages sein. Wenn du drei Monate unterwegs bist, schaffst du es besser, ordentlich durch den Tag zu navigieren, so dass du zur Showtime dann 100 Prozent geben kannst. Bei mir ist das so: gegen 16 Uhr mache ich ein etwa eineinhalbstündiges Schläfchen, weil es mir einen Energiekick gibt. Früher nahm ich dazu Drogen, heute ist jeder brav und gesund. Alle nehmen Vitamine, schlafen viel, essen gesund – wenn du dir das zur Regel machst, eine großartige Show ablieferst und tolle Platten machst, dann kannst du solange auf Tour gehen, wie du willst.








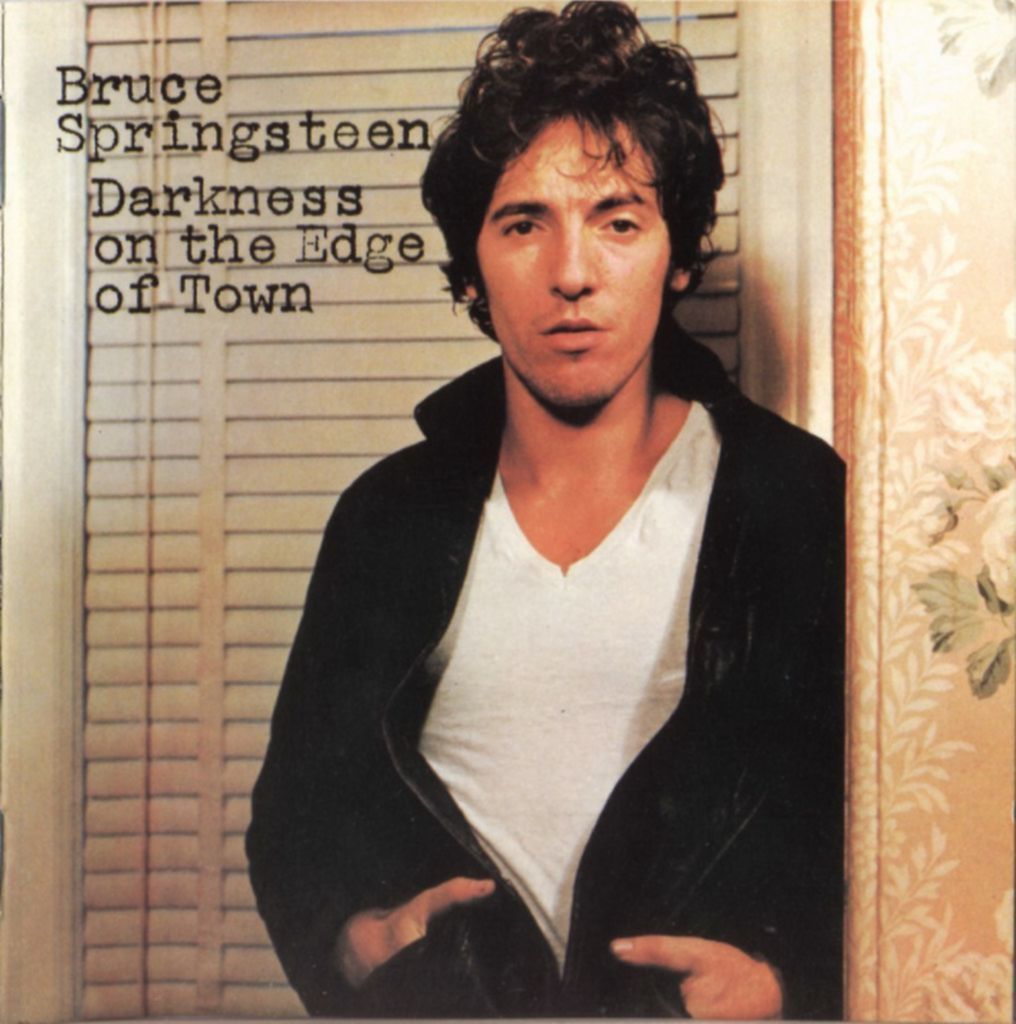







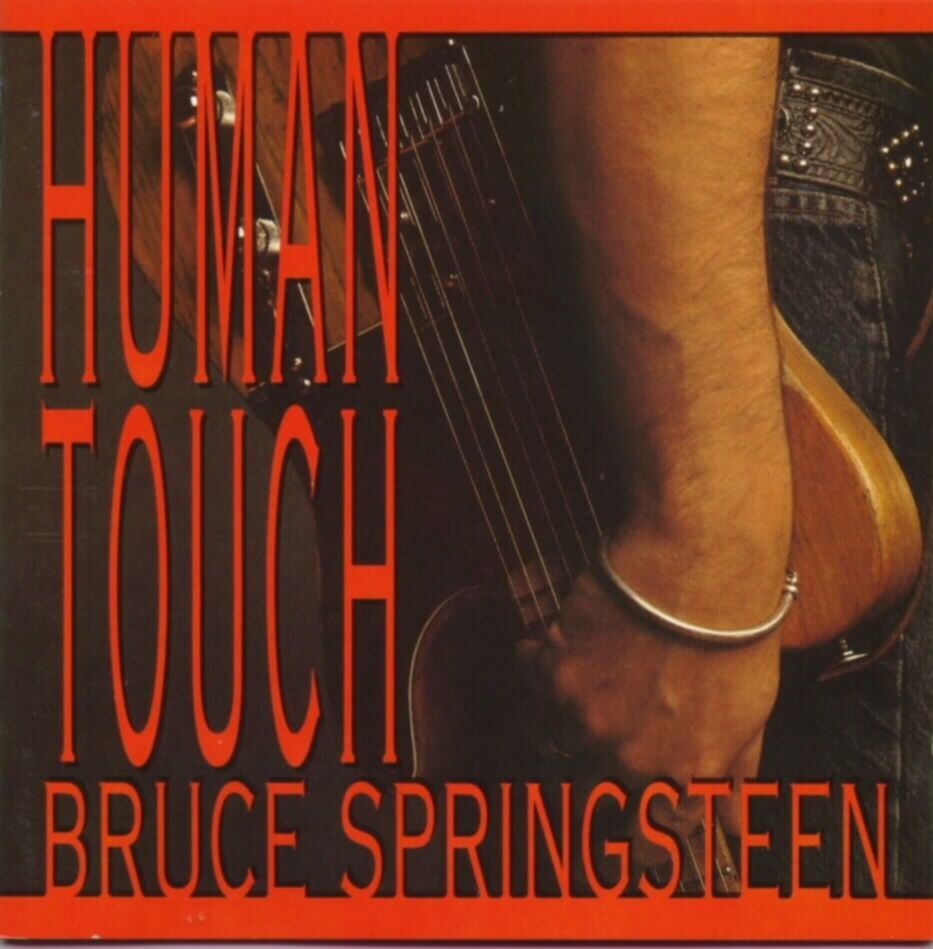

 Joan Jett: Denn sie weiß, was sie tut! Wie ein Teenager von den Runaways zu einer erwachsenen Visionärin für Musik mit Attitüde, humanistische Politik und Gleichberechtigung reifte.
Joan Jett: Denn sie weiß, was sie tut! Wie ein Teenager von den Runaways zu einer erwachsenen Visionärin für Musik mit Attitüde, humanistische Politik und Gleichberechtigung reifte.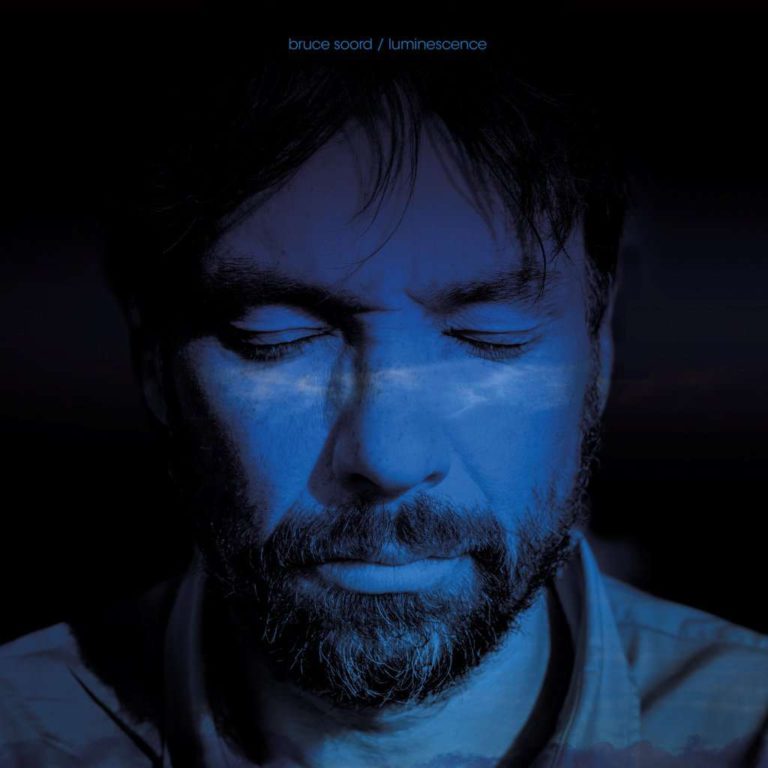




 and then
and then