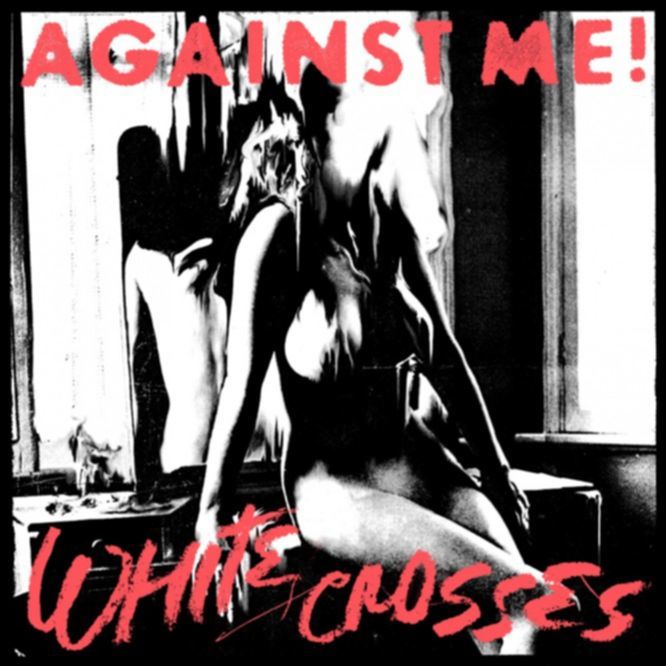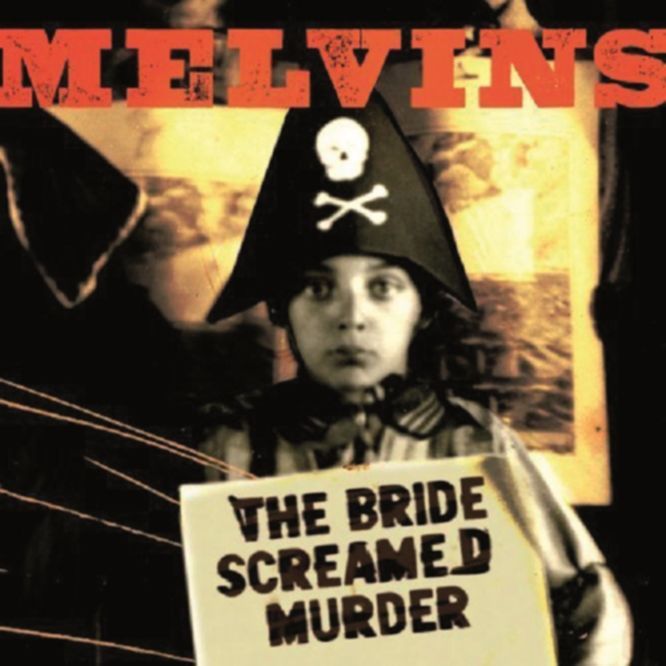Die Schwarte kracht endlich wieder höllisch hymnisch.
Die Schwarte kracht endlich wieder höllisch hymnisch.
Im Fall von David Bowies beiden letzten Veröffentlichungen bemühten die Experten gerne die Einschätzung, dies sei jeweils Bowies beste Platte seit SCARY MONSTES AND SUPER CREEPS. Was das bitteschön – bis auf den Horror-Hauch im Albumtitel – mit Danzig zu tun hat? Ganz einfach: Für DETH RED SABAOTH lässt sich eine analoge Behauptung aufstellen. Denn das neunte Studioalbum des bösen Elvis ist tatsächlich sein bestes nach DANZIG IV von 1994. Zwar nicht von Rick Rubin, sondern von Chef Glenn höchstpersönlich Hand-am-Schritt-produziert, sitzen melodiöses Muskelspiel, das markante, tiefe Gruft-Geheul und die Finster-Stimmung fast wieder so stramm wie einst. Das Gitarrenspiel von Prongs Tommy Victor glänzt im metallischen Mondlicht, und die Rhythmusfraktion aus dem zum Bass konvertierten Steven Zing (Samhain) und Schlagzeuger Johnny Kelly (Type O Negative) macht dämonischen Druck.
Noch viel schöner aber ist, dass Danzig hier endlich wieder durchgängig die Hymnen-Hantel schwingt. Egal ob breitbeinig balladesk wie beim grandiosen, in der Strophe an ›Sweet Dreams (Are Made of This)‹ erinnernden ›Rebel Spirits‹ oder beim harten Eröffnungs-Rocker ›Hammer Of The Gods‹ – nahezu jeder Song strotzt vor fetten Fleischerhaken-Hooks. Wie sein Schöpfer ein kleines teuflisches Meisterwerk.