Ihre vielleicht bekannteste Hymne entstand aus der ungewöhnlichen Verbindung eines Stücks klassischer amerikanischer Literatur und eines durchgeknallten kanadischen Dichters.
Die lange Karriere von Rush ist sicher nicht arm an wichtigen Liedern: ›Working Man‹ war ihr erstes Stück, das auch außerhalb ihrer kanadischen Heimat wichtiges Radio-Airplay verbuchte und zu einem weltweiten Deal mit Mercury Records führte. Ihr Album 2112 sicherte die Zukunft der Band, als dieser Deal an einem seidenen Faden hing. ›The Spirit Of Radio‹ wiederum verhalf ihnen zu der unwahrscheinlichen Ehre eines Top 20-Hits in Großbritannien. Doch der berühmteste Song von allen im Rush-Katalog ist ›Tom Sawyer‹, der Eröffnungs-Track des Albums MOVING PICTURES von 1981, das als bestes und meistverkauftes der Band gilt. „›Tom Sawyer‹ ist eine wahre Erkennungsmelodie für uns“, bestätigt Rush-Gitarrist Alex Lifeson. „Es ist musikalisch sehr kraftvoll und berührt textlich auch viele Menschen. Es ist so was wie eine Hymne.“
Rush standen an einem Scheideweg, als sie ›Tom Sawyer‹ schrieben. In den 70ern waren sie zu den unangefochtenen Meistern des Prog-Hardrock aufgestiegen, berühmt für ihre epischen Konzeptstücke, die sich über komplette Seiten einer Vinylplatte erstreckten. Doch mit dem ersten Album der 80er – PERMANENT WAVES – ging ein bedeutender Wandel einher.
„Wir begannen, kompaktere, sparsamere Stücke zu schreiben.“ Daraus resultierte ebenjene Hitsingle, ›The Spirit Of Radio‹: eine Tour de force des IQ-Rock, eingedampft auf weniger als fünf Minuten. Und der Text passte bestens zu dieser neuen Herangehensweise. Drummer und Bücherwurm Neil Peart, seit 1975 Autor aller Rush-Texte, hatte sich zuvor von antiker Mythologie und Science-Fiction inspirieren lassen, doch für PERMANENT WAVES schrieb er in einfacherem Stil und verlegte sich auf weltlichere Themen. ›Tom Sawyer‹ war das Destillat dieser neuen, modernen Rush: ein kraftvoller, präzise gearbeiteter Hardrocksong mit einer schlagkräftigen, aber höchst philosophischen Botschaft. Und ein Song, den Rush nicht nur einem Titan der amerikanischen Literatur – Mark Twain – zu verdanken hatten, sondern auch einem reichlich sonderbaren Kanadier namens Pye Dubois.
„Geddy Lee nannte es das ‚definierende Stück Musik‘ von Rush in den frühen 80ern.“
Dieser Poet und Lyriker arbeitete mit der Band Max Webster zusammen, die wie Rush aus Ontario stammte. Man war befreundet und nahm für das 1980er Max Webster-Album UNIVERSAL JUVENILES zusammen das Stück ›Battle Scar‹ auf. „Diese Jungs waren dicke Freunde von uns“, erinnert sich Lifeson. „Aber Pye war etwas mysteriös – ein seltsamer Typ! Doch er schrieb großartige Texte. Um 1980 schickte er Neil ein Gedicht mit der Idee, bei einem Lied zu-sammenzuarbeiten. Der ursprüngliche Entwurf hieß ›Louie The Warrior‹.“
Das Gedicht basierte auf Twains Roman „Die Abenteuer des Tom Sawyer“ von 1876, den alle drei Mitglieder in der Schule durchgenommen hatten. Vor allem Peart identifizierte sich mit den Kernthemen des Buchs von Rebellion und Unabhängigkeit. Von „2112“ bis zu ›Freewill‹ auf PERMANENT WAVES war Individualismus ein immer wiederkehrendes Thema in seinen Texten. Was Dubois in ›Louie The Warrior‹ erschuf, war in Pearts Worten „ein Porträt eines modernen Helden“. Lifeson: „Neil nahm diese Idee und massierte sie, entfernte einige von Pyes Versen und fügte sein eigenes Ding hinzu.“ Peart wählte den einfacheren Titel ›Tom Sawyer‹ und vervollständigte den Text mit einem autobiografischen Element. Wie er es ausdrückte: „die Versöhnung des Jungen und des Mannes in mir.“
Die Musik war ebenfalls ein Neubeginn für Rush. Lifeson: „Die Struktur des Songs entwickelt sich sehr interessant, von diesem ersten Vers zu einer Brücke zu einem Refrain und in das Solo, und dann wieder von vorn. Das war für uns damals kein typischer Aufbau.“ Die Musik war ja auch auf unorthodoxe Art und Weise geschrieben worden – zumindest für Rush. „MOVING PICTURES war sehr anders für uns, weil es eher wie ein Jam entstanden war. Vieles von dem Material wurde bei den Aufnahmen geschrieben. Bei ›Tom Sawyer‹ war das jedenfalls der Fall. Wir probten auf einem kleinen Bauernhof außerhalb von Toronto. Die Hälfte der Scheune war eine Garage, die andere Hälfte ein kleiner Proberaum. Für gewöhnlich jammten wir dort drauflos und entwickelten so die Songs.“
Es war Hochsommer, als Rush die Stücke für MOVING PICTURES schrieben. Doch bis sie anfingen, das Album im Le Studio in Morin Heights, Quebec aufzunehmen – demselben Anwesen in den Bergen, wo schon PERMANENT WAVES entstanden war –, hatte ein harter kanadischer Winter begonnen. „Mir war in meinem Leben nie so kalt, soviel steht fest!“, lacht Lifeson. „Wir wohnten in einem Haus an einem See, und das Studio war auf der anderen Seite des Sees. Wenn wir tapfer genug waren, gingen wir zu Fuß durch den Wald. Es war wunderschön, aber es herrschten -40°C! Im Ernst!“ Der Videcoclip zu ›Tom Sawyer‹, der dort gedreht wurde, eröffnet mit Aufnahmen dieser verschneiten Landschaft und endet mit einer Kamerafahrt über den zugefrorenen See.
Über die Aufnahmen sagt Lifeson: „Der Synthesizer ist so etwas wie ein Schlüsselelement auf ›Tom Sawyer‹. Die Keyboards und wir drei harmonierten bestens. Wir hatten immer noch dieses Trio-Gefühl. Außerdem wollten wir immer in der Lage sein, unsere Lieder live so originalgetreu wie möglich zu spielen, also wurde ›Tom Sawyer‹ auch so geschrieben. Da ist keine Rhythmusgitarre unter dem Gitarrensolo oder Ähnliches.“
Der Track wurde zum Wendepunkt in der Entwicklung der Band. Geddy Lee nannte es das „definierende Stück Musik“ von Rush in den frühen 80ern. Über einen Großteil jenes Jahrzehnts nahmen Keyboards eine wichtige Stellung im Klangbild der Band ein. Und knapp vier Jahrzehnte später haben das Lied und seine Botschaft nichts von ihrer Kraft verloren. „Das klingt immer noch bemerkenswert frisch“, stellt Lifeson stolz fest. „Und die Leute identifizierten sich schon immer sehr mit dem Text – dieser Geist der Unabhängigkeit und des Abenteuers. Es ist einfach eines dieser besonderen Lieder.“



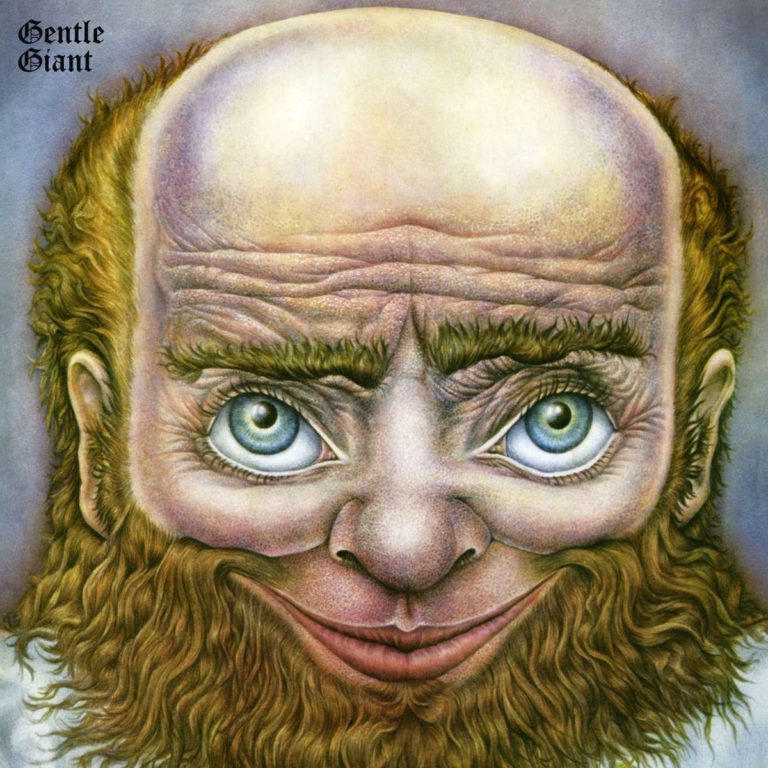

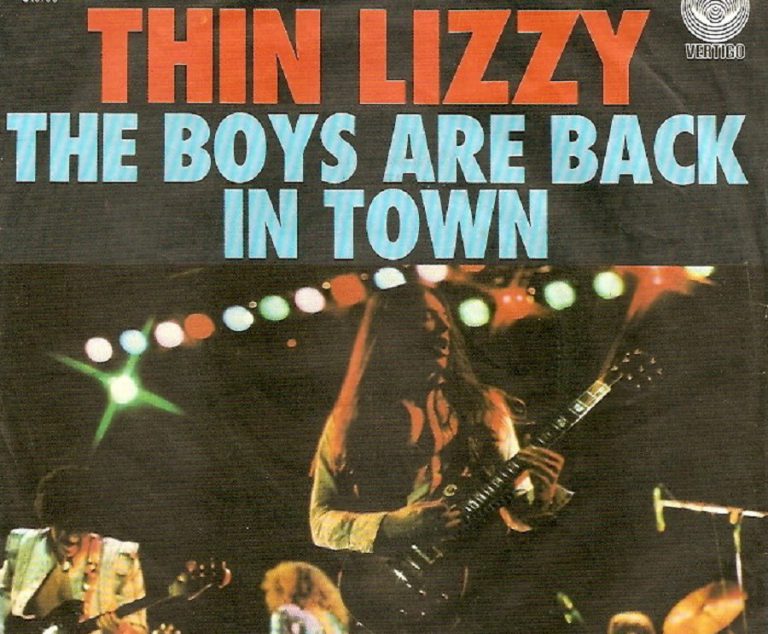



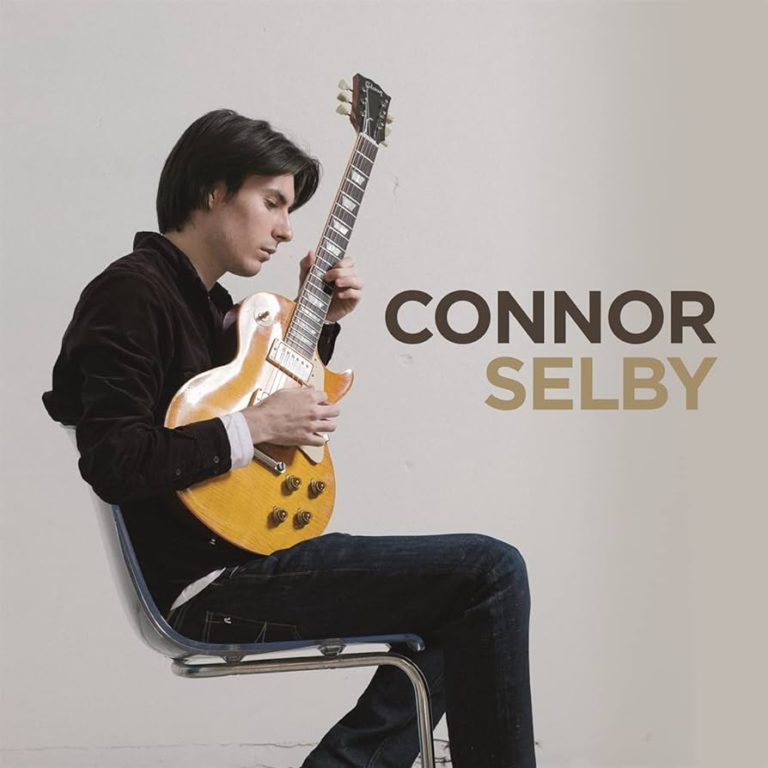
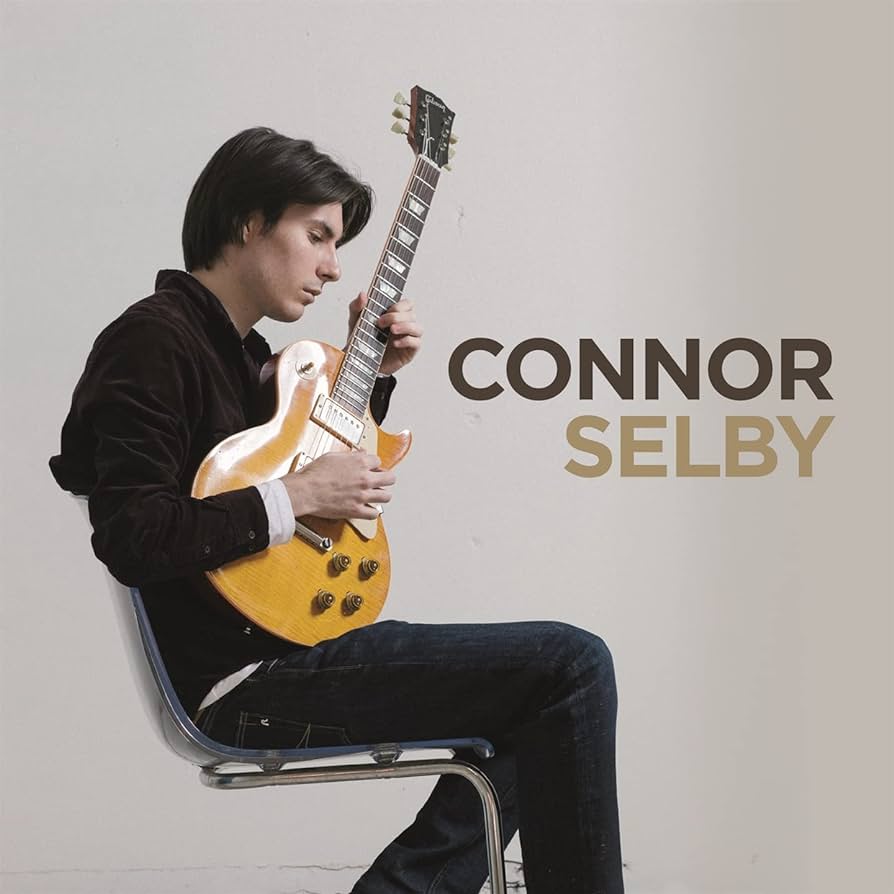



 and then
and then