Die größte und größenwahnsinnigste Band einer an großen und größenwahnsinnigen Bands nicht eben armen Zeit: Led Zeppelin, die Herrscher des Seventies-Rock.
Um das Phänomen Led Zeppelin wirklich zu verstehen, muss man die Lage der Rock-Welt um 1970 begreifen. Rock’n’Roll war zum globalen Wirtschaftsfaktor mutiert, zum Big Business, doch die großen Helden der 60er Jahre schienen mitunter verbraucht – die Beatles waren aufgelöst, die Stones auf Droge und im Steuerexil. Creedence Clearwater Revival hatten zwar ähnliches Mainstream-Potenzial, doch kriselte es auch bei ihnen. Da wurde also eine Lücke frei, und genau die schlossen Led Zeppelin. Was allerdings auch kein Zufall war.
Jimmy Page und John Paul Jones waren bereits damals mit allen Wassern gewaschene Studio-Routiniers, Robert Plant schien für die Rolle des blondgelockten Sängergottes wie geschaffen und John Bonham führte die Tradition exzentrischer Rock-Drummer mit Hingabe fort. Vor allem aber: Manager Peter Grant wusste, wie der Hase läuft, hatte das Business von der Pike auf gelernt und genug Durchsetzungsvermögen, um im damals noch ziemlich halbseidenen Showgeschäft mit Nachdruck zu bestehen. Für seine Schützlinge tat er buchstäblich alles.
Was die künstlerischen Verdienste Led Zeppelins keineswegs schmälert: Ob kompositorisch, produktionstechnisch oder in Sachen Virtuosität – das Quartett setzte Maßstäbe. Von der Kritik meist zerrissen, vom Publikum heiß geliebt, lieferten Led Zep den Soundtrack der 70er. Und flirteten mit all jenen Versuchungen und Verirrungen, die dieses dekadente Rock-Jahrzehnt so exzessiv zu bieten hatte: Glamour, Groupies, schwarze Magie, Koks-Partys in der eigenen Boeing, Prügeleien hinter der Bühne, eitle Selbstdarstellung, Größenwahn, Selbst-zerstörung. Klingt zu negativ? Betrachten wir es wertfrei: Led Zeppelin waren Kinder ihrer Zeit, nahmen mit, was mitzunehmen war, entsprechend ihrer exponierten Stellung auf höchstem Niveau. Und zwar bis zum bitteren Ende, als Bonham mit 40 doppelten Wodkas im Blut die Trommelstöcke abgab.
Es gibt Künstler, bei denen substanziell nicht viel übrig bleibt, wenn man den Superstar-Hype abzieht. Anders Led Zeppelin, die im Kern vor allem eines waren: eine wahnsinnig gute Band, auf allen Positionen glänzend besetzt. Selbst ihre schwächeren Arbeiten waren noch immer überdurchschnittlich, und wenn sie zur Hochform aufliefen, konnten sie wahrhaft Monumentales schaffen. Songs für die Ewigkeit, eine Blaupause für nachfolgende Generationen. Was folgende Wertungen dann auch relativiert: selbst Sonderbares ist bei Led Zeppelin nicht wirklich schlecht.
Unverzichtbar
IV
Atlantic, 1971

Keine Überraschung, oder? Zwar ist ›Stairway To Heaven‹ mittlerweile – nun ja – dann doch ein wenig tot gespielt, doch die lyrische Kraft und die beispielhafte, kluge Dynamik des Songs bleiben davon unberührt. Noch besser: Die ungerade Metrik von ›Black Dog‹, der Fantasy-Folkrocker ›The Battle Of Evermore‹ mit Gastsängerin Sandy Denny, das zartbittere ›Going To California‹ und die Dampfwalze ›When The Levee Breaks‹. Am besten: ›Rock And Roll‹, das so kraftvoll abgeht wie eine Sojus-Rakete in Baikonur. Ein Album ohne einzigen Ausfall, dank der rätselhaft mystischen, je einem Bandmitglied zugeordneten Symbole bisweilen auch ZOSO oder FOUR SYMBOLS genannt.
I
Atlantic, 1969

Warum ist dieses Album unverzichtbar und nicht die Nummer II, auf der doch der Über-Hit ›Whole Lotta Love‹ mit drauf ist? Weil I eben das Debüt war, die Initialzündung und Pioniertat. Demnach also: historisch besonders wertvoll. Keine Band zuvor klang derart kraftvoll, Bonzos Schlagzeug bewegt hörbar eine ganze Menge Luft, die Blues-Adaptionen von Willie Dixon drücken einen fast an die Wand. Page lässt bei ›Dazed And Confused‹ die Telecaster bitterlich weinen und erweist auf ›Black Mountain Side‹ seinem Idol Bert Jansch der Reverenz. Robert Plant liefert prima Vokalakrobatik, nur seine Texte sind noch etwas halbgar. Macht aber nichts.
Wunderbar
II
Atlantic, 1969

Die Fortsetzung des Debüts, stilistisch ähnlich, aber alles in allem schwerblütiger. Dreh- und Angelpunkt war selbstverständlich ›Whole Lotta Love‹, das als Single bis auf Platz 4 der US-Charts stieg und dessen Trademark-Riff so stilprägend war wie Jahre zuvor ›Satisfaction‹ der Stones oder kurz darauf Deep Purples ›Smoke On The Water‹. Außerhalb der USA veröffentlichten Led Zep auf Grants Geheiß keine Singles – die Leute sollten das Album kaufen. Was sie auch taten.: Platz 1 in Deutschland, UK und den USA. Ebenfalls hörenswert: Bonzos Solo auf ›Moby Dick‹.
III
Atlantic, 1970

Man will es kaum glauben, aber die Musikkritik, vor allem die amerikanische, ging mit Led Zep damals überaus hart ins Gericht, von tumben Bluesrockberserkern war da gerne die Rede, die außer „laut“ und „wichtigtuerisch“ nichts draufhätten. III war die passende Antwort: Der vorwärts rumpelnde Opener ›Immigrant Song‹ geriet zwar ein wenig hysterisch, doch dann zogen Led Zep den Hut vor Akustik-Folkies wie Roy Harper und erweiterten ihr Repertoire damit ganz gewaltig. Groß-artig: das Remake des Traditionals ›Gallows Pole‹.
PHYSICAL GRAFFITI
Swan Song Records, 1975

Doppelalben kamen Mitte der 70er in Mode, da mussten natürlich auch Led Zep mitmischen. Was sie mit ihrem sechsten Studioalbum taten. Da nicht genügend neue Songs vorhanden waren, landete auf dem 15 Stücke starken Doppeldecker auch bislang Unveröffentlichtes aus dem Archiv, was der Stringenz erstaunlicherweise keinen Abbruch tat. Ein Album, dessen Anschaffung bereits ein einziger Song rechtfertigt: ›Kashmir‹, jenes orientalisch angehauchte Rhythm & Riff-Monster, das mit seinen achteinhalb Minuten keine Sekunde zu lang ist. Im besten Sinne.
PRESENCE
Swan Song Records, 1976

Als Zeppelins siebtes Studioalbum erschien, waren nicht alle Fans glücklich: Statt sich weiterhin auf Blues-Rock und Akustisches zu beschränken, flirteten Page und Co. in den Münchner Musicland Studios zunehmend mit zeitgenössischen Einflüssen. Der Opener ›Achilles Last Stand‹ kokettierte mit dem aufkommenden Metal, die gesamte Produktion, erstmals ohne Keyboards und Akustikgitarren, zitierte die minimalistische Kühle und Schärfe der New-Wave-Bewegung. Was konservativere Fans als Verrat am heiligen Blues Rock werteten. Dennoch: Ein interessantes Statement.
Anhörbar
HOUSES OF THE HOLY
Atlantic, 1973

Seien wir ehrlich: Dieses Album ist mehr als anhörbar, sogar ziemlich gut. Bassist John Paul Jones brilliert bei ›The Rain Song‹ als Arrangeur und Meister auf dem Mello-tron, der Siebenminüter ›No Quarter‹ avancierte fortan zum zentralen Dauerbrenner im Live-Repertoire, mit ›Over The Hills And Far Away‹ wurde erneut dem Britfolk Tribut gezollt. Einen bedauerlichen Ausfall gibt es allerdings schon zu beklagen: ›D’yer Mak’er‹ war wohl als lustige Reggae-Verballhornung gedacht, ist aber ziemlich albern. Led Zeps ›Ob-La-Di, Ob-La-Da‹. Ein echter Schönheitsfehler.
IN THROUGH THE OUT DOOR
Swan Song Records, 1979

Auch dies ist ein prima Album, manch andere Band wäre froh, ein derartiges Werk vollbracht zu haben. Allerdings sind hier gewisse Verschleißerschei-nungen spürbar: Page laborierte an seinem Heroinproblem, Bonham war meistens voll wie tausend Russen, Plant trauerte noch immer um seinen Sohn. Im Stockholmer „Polar Studio“, Heimstatt der Pop-Könige Abba, traf man sich deshalb nur selten zur selben Zeit. Overdubs hieß das Zauber-wort, was der Studio-Magie dann doch ziemlich abträglich war. John Paul Jones versuchte, alles zusammenzuhalten, doch der Biss war irgendwie weg.
CODA
Swan Song Records, 1982

Der Schwanengesang, veröffentlicht zwei Jahre nach Bonzos Ableben. Im Grunde nichts anderes als eine Resteverwertung, dafür jedoch durchaus brauchbar. Zwei Live-Takes von 1970 zeigen die Band in erfreulicher Form, die 1993 erschienene CD-Ausgabe brilliert gar mit drei weiteren Konzert-Mitschnitten der Jahre 1968 und 1969: vier noch junge Typen, die in vollem Saft standen und das der Welt beweisen wollten. Die sechs, in der CD-Version sieben Studio-Outtakes sind nicht weltbewegend, für Fans aber natürlich dennoch von Interesse. Ein Album, das man kauft, wenn man alles andere bereits hat.
Sonderbar
THE SONG REMAINS THE SAME
Swan Song Records, 1976
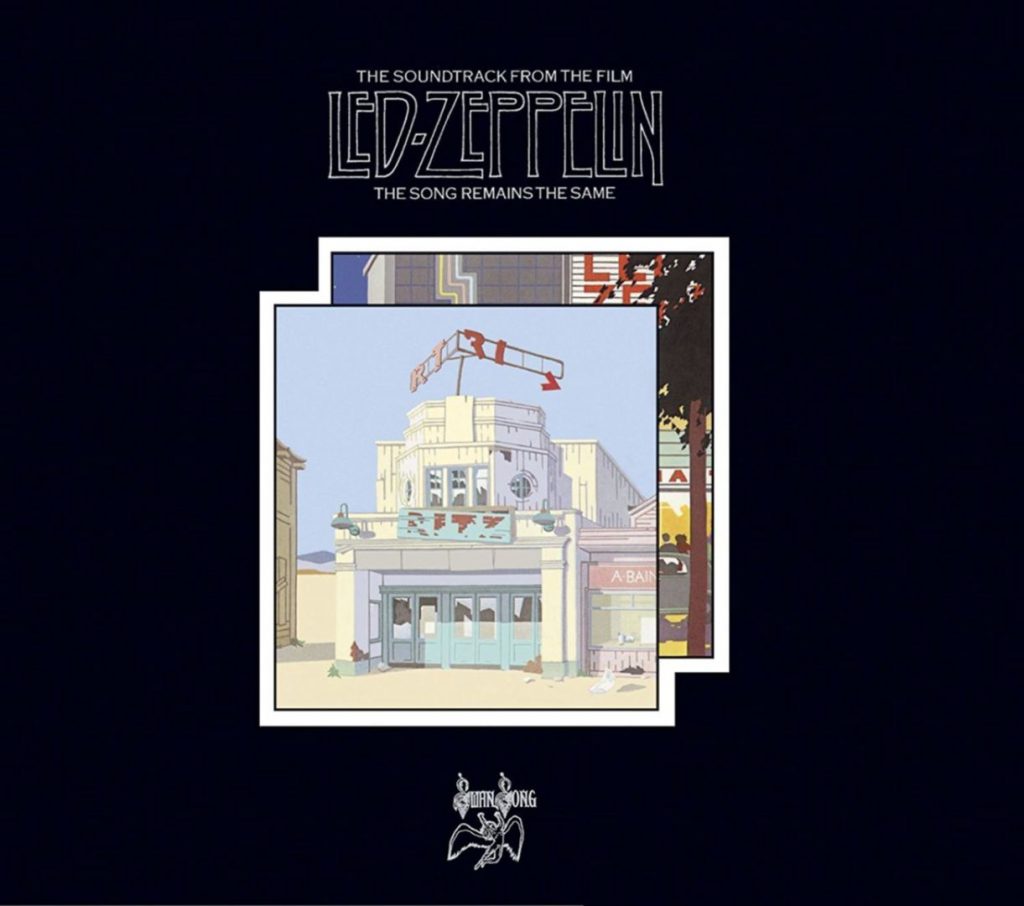
Das einzige zu Lebzeiten der Band erschienene Live-Album, und genau das ist das Problem: Wenn man schon einen Mitschnitt veröffentlicht, dann bitte einen, der die Band in Höchstform präsentiert, was während der Aufnahmen 1973 im Madison Square Garden aber leider nicht der Fall war. Zu wenig für ein Doppelalbum, das konnten Deep Purple mit MADE IN JAPAN deutlich besser. Wer die Originalbesetzung live im Wohnzimmer genießen möchte, greife besser zu HOW THE WEST WAS WON, mitgeschnitten 1972 in Kalifornien, erschienen 2003.

















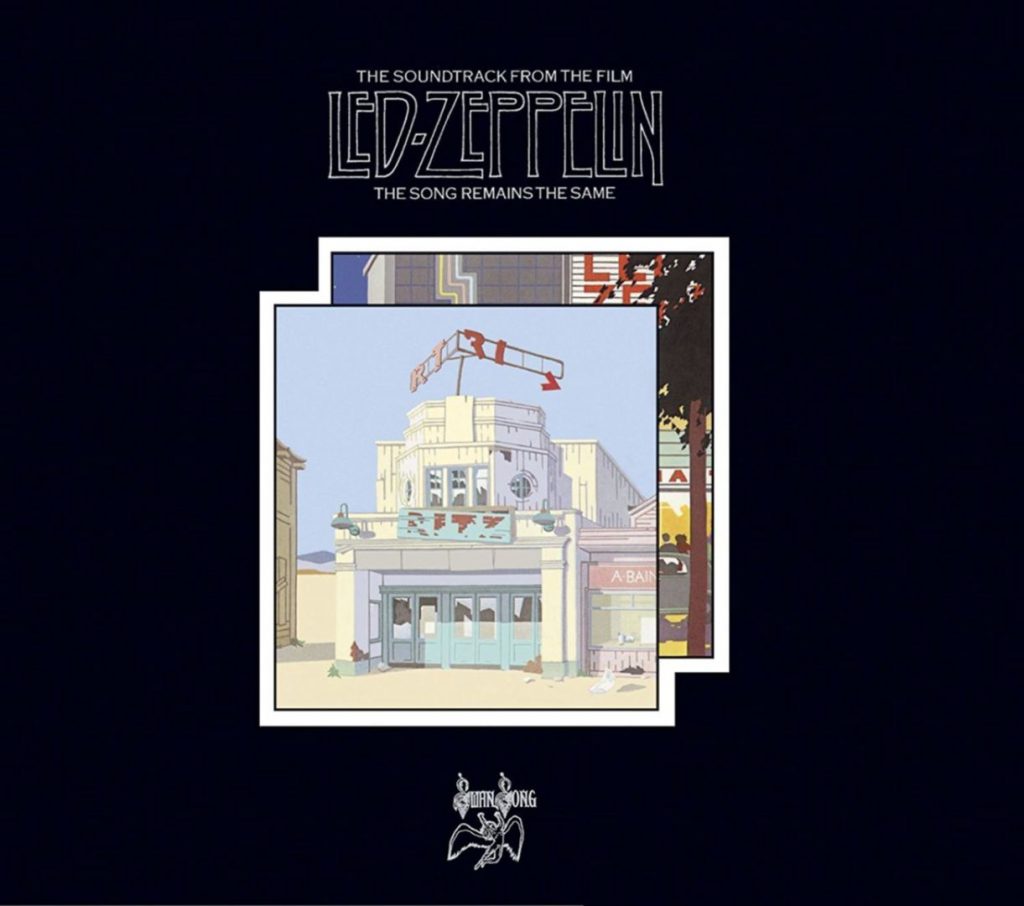





 and then
and then