 Nick Mason hat ein neues Projekt. Doch der Pink Floyd-Drummer macht diesmal nicht in musikalischer Hinsicht von sich reden, sondern ist – gemeinsam mit Mark Hales – Autor des Buchs „Passion For Speed“.
Nick Mason hat ein neues Projekt. Doch der Pink Floyd-Drummer macht diesmal nicht in musikalischer Hinsicht von sich reden, sondern ist – gemeinsam mit Mark Hales – Autor des Buchs „Passion For Speed“.
Darin zollen die beiden ihrer Liebe zu schnellen Autos Tribut – nämlich mit über 400 Hochglanz-Fotos. Doch keine Sorge: Im CLASSIC ROCK-Interview spricht Mason aber nicht nur über Rennen, sondern auch über Rock’n’Roll.
Nick, David Gilmour und Roger Waters haben im Juli bei einer Charity-Veranstaltung wieder gemeinsam auf der Büh-ne gestanden. Wo warst du zu diesem Zeitpunkt?
Bei der Geburtstagsparty von Peter Gabriel. Er wurde 60 und feierte in Italien ein großes Fest. Es traten unter anderem afrikanische Drummer auf, einfach wunderbar! Ich habe mich allerdings zurückgehalten und nicht mitgespielt. Peter übrigens auch nicht. Wir haben es genossen, einfach mal nichts zu tun und das Spektakel als Zuschauer zu genießen. Was den gemeinsamen Auftritt von David und Roger angeht, so kann ich mit Bestimmtheit sagen, dass ich mich darüber freue. Aber es hätte keinen Sinn ergeben, wenn ich auch noch dabei gewesen wäre. Das ist nicht der richtige Ort für eine Pink Floyd-Reunion, obwohl der Anlass natürlich ehrenwert ist. Aber wenn so etwas passiert, dann in einem anderen Rahmen, nicht vor Anzugträgern, Stars und Sternchen. Mir schwebt da eher so etwas wie damals bei Live8 vor.
Wie sieht es denn aus – ist eine Wiedervereinigung der Band etwas, das du in Erwägung ziehst?
Ich hoffe, dass wir es tun. Zumindest verspüre ich Lust dazu. Und die anderen haben ebenfalls Interesse bekundet. Seit unserem Auftritt bei Live8 ist es auch leichter geworden, denn die Show hat uns und den Fans bewiesen, dass wir es durchziehen können. Im Grunde kommt es nun eigentlich nur darauf an, dass jemand von außen an uns herantritt und ein Angebot macht, das uns alle reizt. Ein US-Präsident zum Beispiel… Dann könnten wir sogar darüber nachdenken, mehr als nur ein Konzert zu geben, sondern eine richtige Tour planen. Natürlich würden alle Shows als Benefiz-Gigs angelegt sein, das ist klar. Aber selbst damit muss man vorsichtig sein: Es gibt inzwischen viele Charity-Konzerte, daher sind die Leute diesbezüglich nicht mehr so leicht zu begeistern. Es gibt erste Ermüdungserscheinungen…
Und trotzdem hast du im Mai 2006 an einem Benefiz-Konzert zu Gunsten der „Countryside Alliance“, einer britischen Pro-Jagd-Organisation, im Highclere Castle teilgenommen.
Das ist richtig. Außer mir waren noch Eric Clapton, Roger Waters, Roger Taylor, Georgie Fame, Bryan Ferry, Gary Brooker, Roger Daltrey und viele mehr dabei. Ich stehe nicht besonders auf dieses ganze Tamtam, das ums Jagen und Fischen gemacht wird, aber das Ganze war für mich eine wunderbare Gelegenheit, mit Eric Clapton zusammenzuspielen. Dafür wäre ich sogar zu einem Event der „National Front“ gefahren. Schließlich hat er bzw. Cream mich 1966 erst auf die Idee gebracht, das Hobby Musik wirklich ernsthaft und zielgerichtet zu betreiben.
In den Sechzigern warst du ein junger Rebell, der sich gegen das Establishment gewehrt hat. Heute bist du selbst ein Teil davon. Wie passt das zusammen?
Nun, es ist in der Tat so, dass ich 2010 völlig anders lebe und denke als früher. Wenn mir meine Eltern damals gesagt hätten: „Nick, als 60-Jähriger wirst du nicht einen, sondern zwei Anzüge besitzen“, hätte ich ihnen geantwortet: „Er-zählt doch nicht so einen Quatsch!“ Die Veränderungen, die man im Lauf seines Leben vollzieht, sind wirklich bemerkenswert. Wenn ich heute auf meine Zeit als Twen zurückblicke, sehe ich einen reinrassigen Sozialisten – was ja an sich keine schlechte Sache ist. Dennoch bin ich wirklich erstaunt darüber, wie wenig Ahnung ich damals von der Welt hatte, in welche Richtung sich mein Leben in den folgenden Jahrzehnten entwickeln würde.
Du hast vor wenigen Tagen PASSION FOR SPEED veröffentlicht – ein Coffeetable-Buch, das sich deiner großen Liebe und Leidenschaft widmet: schnellen Autos. Seit wann bist du Renn-Fan?
Mein Vater Bill hat mich dazu gebracht, er produzierte Dokumentationen über Autorennen. Schon als Kind bekam ich mein erstes Auto geschenkt, einen Austin Chummy. Die Rallye-Liebe hat sich übrigens auch weiter vererbt: Meine Kinder sind ebenfalls Fans, besitzen so-gar alle eine Rennlizenz.
Wie sieht es mit den anderen Floyd-Mitgliedern aus – teilen sie deine Begeisterung?
Nun, sie sind zumindest noch nicht in Le Mans an den Start gegangen! David fährt ab und an, aber er hatte einmal einen schweren Unfall, wäre fast eine Klippe hinabgestürzt. Daraufhin hat er umgesattelt – er fliegt inzwischen lieber. Allerdings ist er vor einiger Zeit mit einer großen Militärmaschine gefährlich ins Trudeln geraten – seither lässt ihn seine Frau in kein Gefährt mehr steigen, mit dem man ein Rennen bestreiten könnte. Roger besitzt einige tolle Autos. Diese Sammelleidenschaft scheint typisch für Rockstars zu sein. Immer wenn jemand einen Scheck von der Plattenfirma bekommt, wird er von den Autohändlern in der Gegend umschwärmt – und zwar so lange, bis er sich ein neues, teures Auto zugelegt hat. Daher ist viel von dem Geld, das wir mit Pink Floyd bedient haben, in ihre Taschen gewandert.
Würdest du die Zeit zurückdrehen wollen, wenn du es könntest?
Wenn es um die Band geht: ja. Und in politischer Hinsicht auch. Heute ist alles so verschwommen, es gibt keine klare Linie mehr. Und für Musiker ist es verdammt schwer geworden, von ihren Songs zu leben. Niemand verdient mehr etwas an einem Album. Die Zeiten, in denen die Label-Leute einem großzügige Deals angeboten haben, sind vorbei. Nur mit Konzerten und Merchandise-Verkäufen lassen sich heute noch Einnahmen erzielen. In der Anfangszeit von Pink Floyd kostete ein Ticket noch 75 Cent – nun aber 100 Euro! Platten waren damals zwar billig, aber man musste sie als Fan kaufen, wohingegen sie nun oft nur noch eine Gratis-Beilage der Sonntagszeitung sind. Als wir mit Floyd unseren ersten Deal unterzeichneten, bekamen wir 5.000 Pfund Vorschuss. Das war damals ein kleines Vermögen! Doch die EMI konnte es sich leisten, eine Band wie uns zu fördern, langsam aufzubauen. Erst einmal ein Single-Release, dann ab-warten, wie die Fans die Musik annehmen. Heute muss ein Label 100 Mal so viel Kohle investieren, um die Band nach vorne zu bringen.
Denkst du, dass es noch einmal ein neues Pink Floyd-Album geben wird?
Mit Blick auf die immer geringeren Verkaufszahlen ist das eher unwahrscheinlich. Große Bands setzen halt auf Tourneen, dort kann man noch etwas reißen, insbesondere in Verbindung mit massiven Werbekampagnen. Man muss sich doch nur mal ansehen, wie die Stones an die Sache herangehen. Ein neues Album? Brauchen sie nicht. Sie spielen live – und zwar dieselben 20 Songs, die sie auch in den vergangenen 20 Jahren stets in ihrer Setlist hatten.
Und wie wäre es mit einer Single?
Eine Single? Puh, da ist es wahrscheinlicher, dass wir ein neues Album aufnehmen! Doch das wird wohl nicht passieren, denn ich glaube kaum, dass die Verkäufe die Kosten für die Aufnahmen einspielen würden. Noch nicht einmal bei einer Band, die so groß ist wie Pink Floyd. Und um gleich die Antwort auf die Frage vorwegzunehmen, ob wir jemals wieder gemeinsam auf eine Welttournee gehen werden: Nein, werden wir nicht. Das ist zwar eine schöne, nostalgische Idee. Aber mal ehrlich: Wir werden uns nicht ein Jahr lang im Studio einschließen und dann noch eine Tournee durchziehen. Vor allem nicht jetzt, da Rick nicht mehr lebt. Es wäre auch zu gefährlich: Roger und David würden sich irgendwann gegenseitig umbringen – dann wäre ich das einzige verbliebene Pink Floyd-Mitglied. Obwohl, wo ich gerade darüber nachdenke – das ist doch im Grunde ein guter Plan. Dann wäre ich endlich der Chef von Pink Floyd.














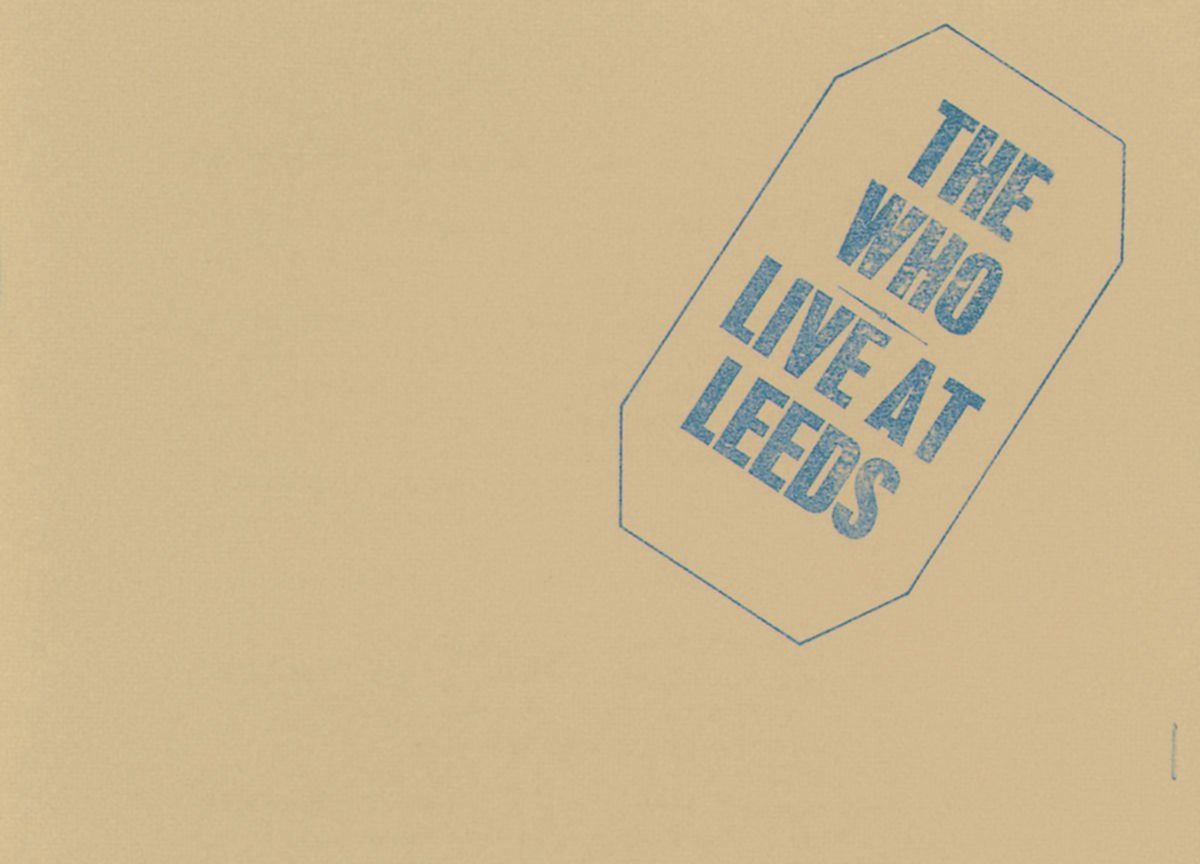


 and then
and then