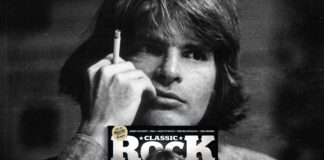(Archiv: CLASSIC ROCK 11/19)
Ein Gespräch über Blondie, Umweltschutz, New York, Andy Warhol, eine unbeschwerte Kindheit, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Bücher, Chris Stein, Frauen in Rockbands und darüber, was es heißt, Punk zu sein.
Die blonden Haare, der kühle, coole Blick: Debbie Harry ist DIE Ikone des Post-Punk. Geboren 1945 als Angela Trimble, wächst sie in New Jersey auf. Es war ein „sorgenfreies Leben“, wie sie heute sagt. Doch weil ein solches dann doch irgendwann langweilig wird, zieht es sie als späte Teenagerin nach New York. Dort schlägt sie sich als Kellnerin im heute legendären Restaurant und Nachtclub Max’s Kansas City durch, wo Lou Reed und Miles Davis zu den Gästen gehören.
Sie lernt Menschen kennen, darunter den für sie wichtigsten: Chris Stein. Er wird bis in die späten 80er ihr Partner sein, sie wird ihn pflegen, nachdem bei ihm 1983 die schwere Autoimmunkrankheit Pemphigus vulgaris diagnostiziert wird – doch zuallererst gründen die beiden 1974 zusammen Blondie. Die Band erobert mit ›Heart Of Glass‹ nicht nur den New Yorker Underground, die unwiderstehliche Debbie Harry vertreibt sich die Zeit mit Kokain und Heroin, hängt mit Andy Warhol, David Bowie, Patti Smith und den Ramones ab.
1982 trennen sich Blondie, seit 1997 sind sie wieder zusammen, vor zwei Jahren haben sie ihr jüngstes Album POLLINATOR veröffentlicht. Harry hat mit Drogen heute nicht mehr viel am Hut, dafür hat sie mit über 60 angefangen zu rauchen, sie geht, wenn möglich, jeden Tag mit den Hunden raus und liest immer morgens eine Stunde in einem Buch. Dazu trägt sie gern Shirts, auf denen Slogans wie „Stop Fucking The Planet“ steht, und gerade hat sie ihre Autobiografie „Face It“ geschrieben. Wir rufen die Sängerin an einem frühen Nachmittag Anfang September in ihrem Hotelzimmer an.
Hallo Debbie, wie geht’s?
Okay, und wie geht’s dir?
Gut. Ich erreiche dich in London, was machst du dort?
Ich darf Mr. Iggy Pop einen Lifetime Achievement Award überreichen.
Oh, wirklich? Cool!
Ja, sehr cool.
Hast du eine gute Zeit?
Ja. Wir sind erst gestern angekommen. Ich hatte einen schönen Abend mit ein paar Freunden. Heute arbeite ich ein bisschen, abends ist die Award-Show und die nächsten Tage ist Presse angesagt.
In deinem neuen Buch schreibst du, dass du jeden Morgen eine Stunde liest. Was war heute dran?
Ein Buch von Bob Dylan.
Welches?
Sein neuestes, mir fällt der Titel gerade nicht ein, seine Autobiografie. (Dabei müsste es sich um „Chronicles, Volume One“ von 2004 handeln, Anm. d. Red.)
Ist es gut?
Exzellent. Er ist ein wunderbarer Schreiber, das fand ich schon immer, auch als er keine Bücher geschrieben hat. Der ganze Rahmen an Bezügen, alles, was er mit einfließen lässt in seine Sachen, ist so schön. Er hat aus so vielen Quellen geschöpft, es ist unglaublich.
Gibt es Bücher, zu denen du immer wieder zurückkehrst?
Die gibt es, aber nur, wenn gerade keine neuen mehr da sind. Letztens habe ich ein Leonardo-Da-Vinci-Buch fertig gelesen, einfach wundervoll, und es liegt noch eine lange Liste vor mir.
„Für mich ging es darum, mich als Mädchen, als Frau in einer Männerwelt zu behaupten, in einem von Männern dominierten Business. Das war sehr punk.“
Macht es Spaß, eine Autobiografie zu schreiben?
Erst nicht, nein. Aber nach einer Zeit bin ich reingekommen, und ab da war es schön.
Wann kam dir die Idee?
Vor ein paar Jahren. Es schien mir eine gute Idee zu sein, angemessen für diese Phase in meinem Leben und meiner Karriere.
Du bist in New Jersey aufgewachsen. Hattest du eine glückliche Kindheit?
Ja, tatsächlich eine sehr privilegierte Kindheit. Nicht, weil wir so reich gewesen wären, aber wegen der ganzen allgemeinen Umstände. Meine Eltern haben gut auf mich aufgepasst, ich bekam eine gute Erziehung mit auf den Weg. Ein sorgenfreies Leben sozusagen. Alles lief noch ein bisschen anders damals, ich hatte Zeit zu spielen und draußen rumzurennen, das Umfeld war eher ländlich. Diese Art von physischer Freiheit ist heutzutage ein echter Luxus.
Wie war es, nach New York zu kommen?
Na ja, sehr aufregend. Angsteinflößend, spannend und faszinierend zugleich. Ich wollte sehen, was so abging in der großen Stadt.
Du hast erst mal als Kellnerin gearbeitet. Wie bist du von da aus zur Musik gekommen?
Einfach. indem ich rumhing und Leute traf. Es ging nicht darum, irgendwas professionell zu machen. Damals gab es diese Dinge, die sie Happenings nannten, wo auf irgendeine Weise freigeistige Leute hingingen. Heute würde man vielleicht Drum-Circles dazu sagen. Alle sitzen rum und spielen Drums, oder singen oder tanzen. Eine ganz andere, hippiemäßige Ära.
Inwiefern hat dein Idol Marilyn Monroe deine Blondie-Figur beeinflusst?
Nun, das ist ziemlich offensichtlich. Die blonden Haare natürlich, und dass sie eine irgendwie witzige Person gewesen ist. Viele ihrer Rollen zeigten attraktive Frauen, sexy Frauen, die in Flirts gerieten, eine gute Zeit hatten und sich mehr auf der albernen Seite bewegten. Eine lebenslustige Figur.
Du schreibst in „Face It“, deine Rolle bei Blondie sei die einer „extrem femininen Frontfrau einer männlichen Rockband in einem klaren Macho-Umfeld“ gewesen. Was brauchte es, um sich da durchzusetzen?
Ich war nicht direkt die Anführerin der Band, Chris (Stein) und ich haben sie zusammen gegründet. Aber ich hatte eine Vorstellung davon, wessen Zeit gekommen war, und fühlte, dass es da draußen viele Girls gab, die was auf die Beine stellen, Musik machen wollten. Und ich bin einfach drangeblieben.
Was bedeutet es, Punk zu sein?
Nun, mal sehen. Irgendwie anders zu sein, sich über einige der Standardvorstellungen lustig zu machen. Für mich ging es darum, mich als Mädchen, als Frau in einer Männerwelt zu behaupten, in einem von Männern dominierten Business. Das war sehr punk.
Du verrätst im Buch, dass du ganz zu Beginn deiner Karriere von einem Mann vergewaltigt wurdest, der Jimi Hendrix ähnlich sah. Das hat dich aber nicht sonderlich beeindruckt, du sorgtest dich mehr um die Instrumente, die er gestohlen hatte.
Nein, denn ich war nicht verletzt. Ich fühlte mich nicht körperlich missbraucht, außer, dass mir vielleicht mein Stolz genommen worden war. Ich war wohl eine rational denkende Person. Wenn ich auf schlimmere Weise geschlagen oder physisch verletzt worden wäre, hätte die Sache wahrscheinlich anders ausgesehen.
Erinnerst du dich noch, wie du Andy Warhol zum ersten Mal getroffen hast?
Ja, wir sind an der Ecke Broadway und 13th Street zufällig in ihn reingelaufen. Chris und ich gingen gerade rüber zum Union Square, Andy hatte dort sein Studio, er nannte es Factory. Es war also gar nicht so unwahrscheinlich, dass man ihm dort begegnet, auch wenn wir es nicht geplant hatten. Es war nett, Hallo zu sagen.
Weißt du noch das Jahr?
Ooh! Nein, tatsächlich nicht. Es war in den 70ern, vielleicht 1975 oder so.
Welchen Eindruck hattest du von ihm?
Er war immer so süß. Auf gewisse Weise ein rätselhafter Charakter, aber sehr überschwänglich, als wir ihn zum ersten Mal trafen. Er wusste, wer wir waren, und sagte einfach: Oh! Hi! Schön, euch zu treffen, schön, euch zu sehen! Bla bla bla. Sehr locker.
Was gefiel dir an ihm?
Er hat einen neuen Weg eingeschlagen, hatte seine ganz eigene Agenda. Er überschritt viele Grenzen und Gewohnheiten in der Kunstwelt, er mochte einzigartige Individuen und schien sich für dieselben Leute zu interessieren, die auch ich interessant fand. Dazu ging er viel aus, lebte nicht zurückgezogen, sondern traf Leute, und dachte fortschrittlich. Wir alle liebten das. Als er starb, herrschte große Trauer in der Kunst- und Musikszene Downtowns, es war ein großer Verlust für uns, weil er für so vieles stand.
Können wir ein kleines Spiel machen, bei dem ich dir ein paar Namen gebe, und du sagst mir, was dir spontan einfällt?
Na klar!
David Bowie
Umwerfend.
Basquiat
Fragil.
Patti Smith
Genial.
Phil Spector
Verrücktes Genie.
Joey Ramone
Liebenswert.
Ist es ein Fehler gewesen, Blondie als demokratische Band zu gründen, in der jeder das gleiche Mitspracherecht hatte?
Auf gewisse Weise ja, auf gewisse Weise nein. Es stellte eine idealistische Sache dar. Aber viele Bands werden wahrscheinlich so gegründet. Ich kann nicht wirklich etwas daran bedauern. Oder doch, kann ich, aber nicht die komplette Idee an sich. Es sind gute und schlechte Dinge passiert. Das Ganze hat seinen Zweck erfüllt, denn wenn du aus dieser Perspektive handelst, ist das eine gesunde Einstellung.
Worüber habt ihr euch in der Band gestritten?
Hm, nun, die normalen Sachen. Man versucht, kreativ zu sein, und jeder hat seine eigenen Ideen. Und manchmal prallen diese Ideen aufeinander. Aber mir fällt jetzt gar nichts Spezifisches ein. Doch das ist ja auch das Schöne: Alle haben verschiedene Vorstellungen, die du versuchst, unter einen Hut zu bringen, und manchmal musst du einen Schritt zurücktreten und einer anderen Idee den Vorrang lassen. Das ist ganz normal.
Glaubst du, dass die Streitigkeiten bei Blondie und der Tourstress mit verantwortlich waren für die Erkrankung von Chris Stein in den frühen 80ern?
Nein, nein, definitiv nicht! Stress ist natürlich sehr gefährlich, klar. Aber darüber kann einem jemand, der auf dem Gebiet der Medizin arbeitet, sicher mehr erzählen.
Im Buch schreibst du, dass Chris vielleicht die wichtigste Person in deinem Leben ist. Was magst du an ihm?
Ich weiß nicht, so was ist schwer zu erklären, denn es passiert nicht allzu oft. Wir verstehen uns gegenseitig sehr gut, ich liebe seinen Humor, seine Intelligenz und seine Großzügigkeit. Er ist eine liebe Person mit beißenden Witz, eine ganz ungewöhnliche Kombination. Mir gefällt ganz einfach, was er sagt, und jemanden wie ihn in meinem Leben zu haben und mit ihm zu arbeiten, ist unglaublich. Ein großes Glück!
Als er dich Ende der 90er wegen einer Blondie-Reunion anrief, hieltest du ihn für verrückt. Wieso?
Weil es mir wie eine absurde Idee vorkam.
Wieso das?
Nach all dem Ärger und der harten Arbeit, durch die wir gegangen waren, kam es mir dumm vor, wieder zurückzugehen.
Aber es scheint funktioniert zu haben. Das jüngste Blondie-Album ist vor zwei Jahren erschienen, es heißt POLLINATOR, auch weil dir das Überleben der Bienen und Umweltschutz allgemein am Herzen liegen. Siehst du Hoffnung für uns in der Zukunft?
Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir alle sehen, wie entscheidend das alles ist und wie schnell wir etwas unternehmen müssen. Ich glaube an das, was die Wissenschaftler sagen, wir haben Verantwortung für die Zukunft, für den Planeten. Es geht um eine Art des Denkens, um ein natürliches Verständnis, das frühere Zivilisationen und indigene Völker hatten, und das uns in der modernen Welt auf gewisse Weise verloren gegangen ist. Und darum müssen wir jetzt kämpfen, wir müssen kämpfen wie verrückt!